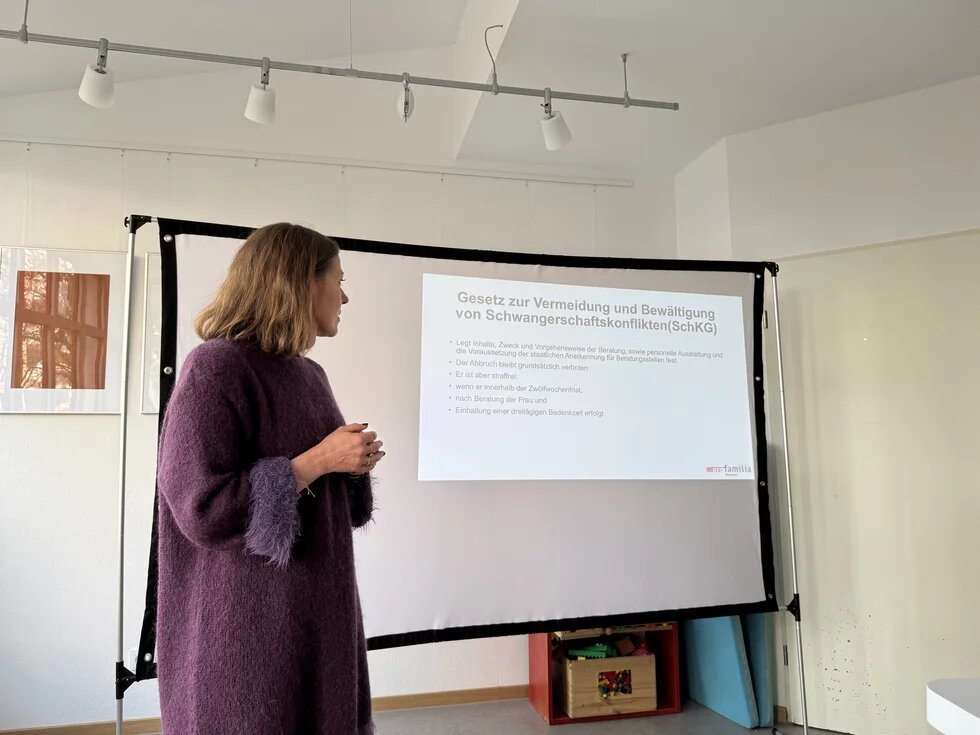Am 21. Februar fand in München erstmals die Feministische Werkstatt zum Thema „Schwangerschaftsabbruch geht uns alle an“ statt. Eingeladen hatte die Petra-Kelly-Stiftung in Kooperation mit Pro Familia München und Pia (pro familia in action) in die Räume von siaf e.V., um über die aktuelle politische Lage und die besonderen Hürden in Bayern rund um § 218 aufzuklären.

Paragraph 218: Empfehlungen, Entwürfe – Entkriminalisierung:
Amina Nolte vom Gunda-Werner-Institut beleuchtete in ihrem Vortrag „Empfehlungen, Entwürfe – Entkriminalisierung?“ die historischen Entwicklungen, wissenschaftliche Erkenntnisse und politische Debatten zum Thema. Sie stand im engen Austausch mit der Expertenkommission des Bundestags, die im April empfahl, Schwangerschaftsabbrüche in der Frühphase nicht mehr grundsätzlich strafbar zu machen. Nachdem die Ampelkoalition zerbrochen war, scheiterten Initiativen von SPD und Grünen, das Vorhaben noch vor der Bundestagswahl am 23. Februar umzusetzen, an der fehlenden Mehrheit. Nolte sieht jedoch Potenzial für Veränderungen – insbesondere durch zivilgesellschaftlichen Druck auf die Bundesregierung. Beispiele aus Frankreich, Kanada und den Niederlanden zeigen, dass eine Liberalisierung möglich ist: Dort wurden politische Entscheidungen zugunsten ungewollt Schwangerer getroffen. Auch die Menschenrechtsausschüsse der Vereinten Nationen betonen, dass Schwangerschaftsabbrüche Teil des Rechts auf körperliche Autonomie und Selbstbestimmung sind.
Amina Nolte ging zudem auf die Ergebnisse der ELSA-Studie ein, die zeigt, dass eine Streichung des § 218 in Deutschland parteiübergreifend breite Unterstützung findet. Entgegen der Behauptung eines „gesellschaftlichen Großkonflikts“ (Friedrich Merz) deuten die Studienergebnisse auf ein hohes Maß an gesellschaftlicher Einigkeit hin.
Der bayerische Sonderweg beim § 218
Im Anschluss berichtete Natasha Endres von Pro Familia München über die spezifischen Hürden für ungewollt Schwangere in Bayern. Besonders problematisch sind die Stadt-Land-Unterschiede: Während in Ballungsräumen vergleichsweise gute Versorgungsangebote bestehen, ist die Lage im ländlichen Raum oft prekär. Bayern stellt zudem zusätzliche Hürden auf: Schwangere müssen explizit an der Beratung mitwirken, und niedergelassene Ärzt*innen dürfen künftig nur noch maximal 25 % der Abbrüche nach dem Beratungsmodell finanzieren. Ärzt*innen sind außerdem verpflichtet, Abbrüche abzulehnen, wenn die Schwangere die Gründe für ihre Entscheidung nicht offenlegt.
Ein weiterer Rückschritt war das Verbot der Telemedizin bei medikamentösen Schwangerschaftsabbrüchen im Dezember 2024. Kritiker*innen bemängeln, dass Schwangeren damit leichtfertiges Handeln unterstellt wird und dass ein wichtiges Versorgungsangebot insbesondere in strukturschwachen Regionen wegfällt. Die Einschränkung der Wahlfreiheit der Schwangeren, die Unterstellung möglicher Manipulationen und die Missachtung der Berufsfreiheit von Ärzt*innen stoßen auf breite Kritik.
Im Anschluss an die Vorträge boten Pia und die Wissenschaftlerin Elisabeth Wiesnet Kurzworkshops an, in denen Argumentationsstrategien und Bedarfe ungewollt Schwangerer im Fokus standen.
Insgesamt diente die Veranstaltung der Vernetzung, dem Austausch und der Stärkung engagierter Akteur*innen. Das Format war offen für alle Interessierten – eine Fortsetzung ist bereits geplant.